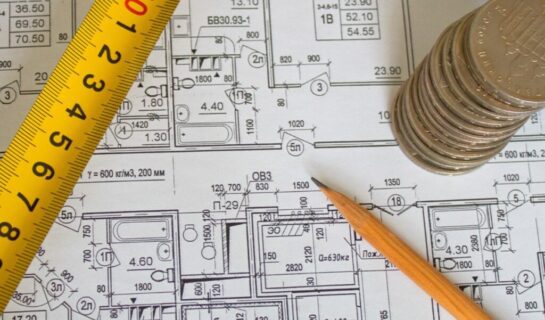Ein Mahnbescheid im Briefkasten – unerwartet und oft beunruhigend. Doch Ignorieren ist keine Lösung, denn die Frist zur Reaktion ist kurz und die Folgen können gravierend sein. Wer jetzt die richtigen Schritte kennt, kann finanzielle Nachteile abwenden und seine Rechte effektiv wahren. Erfahren Sie, wie Sie sich korrekt verhalten und was bei einem Mahnbescheid wirklich zählt.
Übersicht
- 1 Das Wichtigste: Kurz & knapp
- 2 Mahnbescheid erhalten: Was bedeutet das rechtlich für Sie?
- 3 Prüfung des Mahnbescheids: Ihre Rechte und Pflichten als Schuldner
- 4 Widerspruch gegen den Mahnbescheid: Möglichkeiten und Konsequenzen
- 5 Vollstreckungsbescheid: Rechtliche Folgen bei ausbleibendem Widerspruch
- 6 Zahlungsvereinbarungen und Schuldnerberatung: Rechtliche Optionen zur Schuldenregulierung
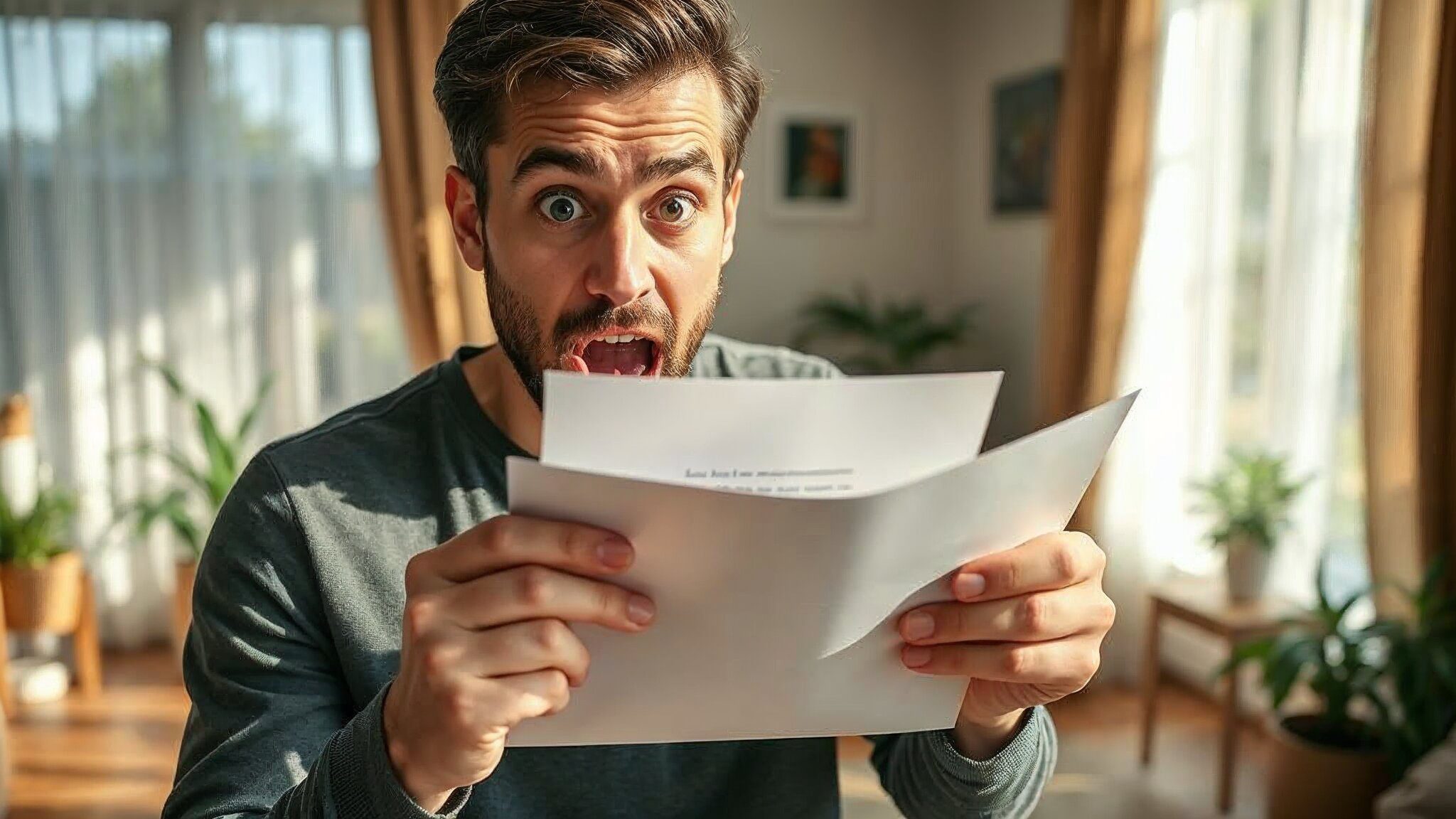
Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Definition: Ein Mahnbescheid ist ein amtliches Dokument vom Gericht, mit dem ein Gläubiger eine Geldforderung geltend macht, ohne direkt zu klagen.
- Reaktionsfrist: Sie haben genau zwei Wochen ab Zustellung, um zu reagieren (Datum auf dem gelben Umschlag ist entscheidend).
- Handlungsoptionen:
- Zahlen (wenn die Forderung berechtigt ist)
- Widerspruch einlegen (wenn die Forderung unberechtigt ist)
- Teilwiderspruch einlegen (wenn die Forderung teilweise berechtigt ist)
- Wichtig: Das Gericht prüft NICHT, ob die Forderung tatsächlich berechtigt ist!
- Widerspruch:
- Muss schriftlich erfolgen (am besten mit beigefügtem Formular)
- Muss Ihre Unterschrift tragen
- Muss innerhalb der Zwei-Wochen-Frist beim Gericht eingehen
- Braucht zunächst keine Begründung
- Bei Nichtreaktion: Droht ein Vollstreckungsbescheid, mit dem der Gläubiger direkt Pfändungsmaßnahmen einleiten kann.
- Vollstreckungsbescheid:
- Dagegen ist nur noch Einspruch innerhalb von zwei Wochen möglich
- Bei versäumter Frist wird er rechtskräftig wie ein Urteil
- Zahlungsprobleme: Bei berechtigter Forderung, aber Zahlungsschwierigkeiten, versuchen Sie eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Gläubiger auszuhandeln.
- Verjährung: Prüfen Sie bei älteren Forderungen, ob diese bereits verjährt sein könnten (reguläre Frist: 3 Jahre, beginnend am Ende des Entstehungsjahres).
- Schuldnerberatung: Bei finanziellen Schwierigkeiten suchen Sie frühzeitig professionelle Hilfe bei anerkannten Schuldnerberatungsstellen.
Mahnbescheid erhalten: Was bedeutet das rechtlich für Sie?
Der Erhalt eines gerichtlichen Mahnbescheids, oft zugestellt in einem auffälligen gelben Umschlag mittels Postzustellungsurkunde, ist ein wichtiger rechtlicher Vorgang. Es signalisiert, dass ein Gläubiger – also jemand, der glaubt, Geld von Ihnen zu bekommen – seine Forderung nun offiziell über das Gericht geltend macht. Dies ist mehr als eine private Zahlungserinnerung und erfordert Ihre Aufmerksamkeit, da wichtige Fristen zu laufen beginnen. Untätigkeit kann nachteilige Folgen haben.
Rechtliche Bedeutung eines Mahnbescheids im Zivilrecht
Ein Mahnbescheid ist ein amtliches Dokument, das von einem zentralen Amtsgericht auf Antrag eines Gläubigers ausgestellt wird. Ziel ist es, eine Geldforderung gegen einen Schuldner im sogenannten gerichtlichen Mahnverfahren durchzusetzen. Dieses Verfahren ist Teil des Zivilrechts.
Es ist entscheidend zu verstehen: Das Gericht prüft bei Erlass des Mahnbescheids nicht, ob die Forderung des Gläubigers tatsächlich berechtigt ist. Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, das lediglich auf den Angaben des Antragstellers beruht.
Ein Mahnbescheid muss bestimmte Angaben enthalten (gemäß § 692 der Zivilprozessordnung, ZPO):
- Name und Anschrift des Gläubigers (Antragsteller) und des Schuldners (Antragsgegner).
- Die genaue Höhe der geforderten Hauptsumme sowie eventuelle Nebenforderungen wie Zinsen und Kosten.
- Die Bezeichnung des Anspruchs (z.B. „aus Warenlieferung vom…“, „aus Darlehensvertrag vom…“).
- Die Aufforderung, die Schuldsumme binnen zwei Wochen seit Zustellung zu bezahlen oder, falls die Forderung bestritten wird, innerhalb derselben Frist Widerspruch einzulegen.
- Der Hinweis auf die Folgen, wenn nicht fristgerecht reagiert wird.
Die Zustellung erfolgt formal durch die Post mit einer Postzustellungsurkunde, auf der das Zustelldatum vermerkt ist. Dieses Datum ist entscheidend für den Beginn der Zwei-Wochen-Frist.
Die wichtigsten rechtlichen Funktionen des Mahnbescheids sind:
- Er setzt die zweiwöchige Frist für Zahlung oder Widerspruch in Gang.
- Er ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass der Gläubiger bei ausbleibender Reaktion den nächsten Schritt einleiten kann: den Erlass eines Vollstreckungsbescheids.
- Er hemmt die Verjährung der Forderung. Das bedeutet, dass die Zeit, innerhalb derer der Gläubiger seinen Anspruch gerichtlich durchsetzen kann, durch den Antrag auf Erlass des Mahnbescheids gehemmt wird.
Wichtig ist jedoch: Der Mahnbescheid selbst ist noch kein Vollstreckungstitel. Das heißt, allein auf Grundlage des Mahnbescheids kann der Gläubiger noch keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (wie z.B. eine Kontopfändung) einleiten.
Forderungsanspruch und gerichtliches Mahnverfahren: Grundlagen verstehen
Hinter jedem Mahnbescheid steht ein behaupteter Forderungsanspruch. Das ist das Recht eines Gläubigers, von einem Schuldner eine bestimmte Leistung – in diesem Fall die Zahlung eines Geldbetrages – zu verlangen. Dieser Anspruch kann aus verschiedensten Gründen entstehen, z.B. aus einem Kaufvertrag, einem Mietvertrag, einem Dienstleistungsvertrag oder einem Darlehen.
Das gerichtliche Mahnverfahren ist ein spezielles Verfahren vor den Amtsgerichten, das Gläubigern ermöglicht, Geldforderungen schnell, einfach und kostengünstig durchzusetzen, ohne sofort eine aufwendige Klage einreichen zu müssen. Es ist besonders dann sinnvoll, wenn der Gläubiger davon ausgeht, dass der Schuldner die Forderung wahrscheinlich nicht bestreiten wird.
Der Ablauf ist stark standardisiert und läuft in der Regel schriftlich ab, ohne mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme über das Bestehen des Anspruchs. Der Mahnbescheid ist dabei der erste formelle Schritt. Reagiert der Schuldner nicht fristgerecht durch Zahlung oder Widerspruch, kann der Gläubiger im zweiten Schritt den Erlass eines Vollstreckungsbescheids beantragen. Dieser ist dann – anders als der Mahnbescheid – ein Vollstreckungstitel, aus dem der Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreiben kann. Legt der Schuldner hingegen Widerspruch ein, kann das Verfahren auf Antrag einer Partei in ein normales Klageverfahren übergehen.
Prüfung des Mahnbescheids: Ihre Rechte und Pflichten als Schuldner
Wenn Sie einen gelben Briefumschlag vom Gericht erhalten, handelt es sich wahrscheinlich um einen Mahnbescheid. Dieses gerichtliche Schreiben sollten Sie keinesfalls ignorieren. Als Empfänger haben Sie bestimmte Rechte und Pflichten, die Sie kennen müssen, um richtig zu reagieren. Der Mahnbescheid ist Teil des gerichtlichen Mahnverfahrens, einem vereinfachten Verfahren zur Durchsetzung von Geldforderungen gemäß §§ 688 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO).
Inhaltliche und formelle Anforderungen an einen gültigen Mahnbescheid
Ein Mahnbescheid wird vom zuständigen Amtsgericht (Mahngericht) auf Antrag eines Gläubigers erlassen. Damit er formal wirksam ist, muss er bestimmte Angaben enthalten:
- Die genaue Bezeichnung des Antragstellers (Gläubiger) und des Antragsgegners (Schuldner), einschließlich ihrer Adressen. Sind Anwälte beteiligt, müssen auch diese genannt werden.
- Die exakte Bezeichnung der geltend gemachten Forderung, unterteilt nach Hauptforderung (z.B. aus einem Kaufvertrag, einer Rechnung) und dem geforderten Betrag.
- Die Angabe von Zinsen (mit Zinssatz und Zinsbeginn) sowie eventueller Nebenforderungen (z.B. Mahnkosten).
- Die Kosten des Mahnverfahrens selbst (Gerichtskosten) und gegebenenfalls die Anwaltskosten des Gläubigers.
- Eine Aufstellung der Gesamtsumme, die vom Schuldner gefordert wird.
Fristenregelung: Wann und wie Sie auf den Mahnbescheid reagieren müssen
Nachdem Ihnen der Mahnbescheid zugestellt wurde (das Zustelldatum ist auf dem gelben Umschlag vermerkt und entscheidend!), haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
- Zahlung: Sie erkennen die Forderung an und bezahlen den gesamten im Mahnbescheid genannten Betrag inklusive aller Kosten und Zinsen. Damit ist das Verfahren für Sie erledigt.
- Widerspruch: Sie halten die Forderung ganz oder teilweise für unberechtigt und legen Widerspruch ein.
Für den Widerspruch gilt eine sehr wichtige Frist von zwei Wochen ab der Zustellung des Mahnbescheids.
Um Widerspruch einzulegen, nutzen Sie am besten das dem Mahnbescheid beigefügte Formular. Kreuzen Sie an, ob Sie der Forderung insgesamt oder nur teilweise widersprechen, und senden Sie das Formular unterschrieben an das Mahngericht zurück. Eine Begründung für den Widerspruch ist an dieser Stelle noch nicht erforderlich.
Reagieren Sie jedoch nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist (weder durch Zahlung noch durch Widerspruch), kann der Gläubiger den nächsten Schritt gehen: Er kann einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Aus diesem kann er dann die Zwangsvollstreckung (z.B. eine Kontopfändung) gegen Sie betreiben. Schnelles Handeln ist daher geboten.
Widerspruch gegen den Mahnbescheid: Möglichkeiten und Konsequenzen
Der Erhalt eines Mahnbescheids erfordert Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Handeln. Es ist wichtig zu wissen, dass das Gericht bei Erlass des Mahnbescheids nicht prüft, ob die Forderung tatsächlich berechtigt ist. Deshalb müssen Sie selbst kritisch prüfen, ob die geltend gemachte Forderung korrekt ist. Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten: die Forderung bezahlen oder Widerspruch einlegen.
Widerspruchsverfahren: Ablauf und rechtliche Wirkung
Wenn Sie der Meinung sind, dass die im Mahnbescheid genannte Forderung ganz oder teilweise unberechtigt ist, können Sie Widerspruch einlegen. Dies ist Ihr formales Recht, sich gegen die Forderung zur Wehr zu setzen. Der Widerspruch muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Mahnbescheids beim zuständigen Gericht eingehen.
Ablauf des Widerspruchs
- Frist: Der Widerspruch muss innerhalb von zwei Wochen nach der Zustellung des Mahnbescheids beim zuständigen Mahngericht eingehen. Entscheidend ist das Datum, das auf dem gelben Umschlag vermerkt ist, mit dem der Mahnbescheid zugestellt wurde. Bewahren Sie diesen Umschlag daher unbedingt auf! Die Einhaltung dieser Frist ist entscheidend.
- Form: Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen. Dem Mahnbescheid liegt in der Regel ein Formular bei, dessen Nutzung empfohlen wird, aber nicht zwingend ist. Wichtig ist, dass Ihr Widerspruchsschreiben klar erkennen lässt, dass Sie gegen den Mahnbescheid Widerspruch einlegen und Ihre Unterschrift trägt. Eine E-Mail genügt nicht. Das zuständige Gericht ist das Mahngericht, das den Bescheid erlassen hat (die Adresse steht auf dem Mahnbescheid). Der Widerspruch kann auch mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts erklärt werden.
- Begründung: Eine Begründung für den Widerspruch ist im Mahnverfahren zunächst nicht erforderlich. Es genügt die Erklärung, dass Sie widersprechen. Sinnvoll ist ein Widerspruch insbesondere, wenn:
- die Forderung aus Ihrer Sicht gar nicht besteht.
- die geforderte Summe falsch ist (zu hoch).
- Sie die Leistung bereits bezahlt haben.
- die Forderung bereits verjährt ist.
- Sie nicht der richtige Adressat der Forderung sind.
Folgen des Widerspruchs
Mit dem rechtzeitigen Eingang des vollständigen Widerspruchs beim Mahngericht ist das Mahnverfahren beendet. Der Antragsteller (Gläubiger) erhält hierüber eine Nachricht. Er hat nun zwei Optionen:
- Er kann die Angelegenheit auf sich beruhen lassen.
- Er kann die Abgabe des Verfahrens an das für ein streitiges Verfahren zuständige Prozessgericht beantragen.
Entscheidet sich der Antragsteller für das streitige Verfahren, wird die Angelegenheit an ein normales Zivilgericht abgegeben. Dieses fordert den Antragsteller dann auf, seine Forderung wie in einer Klage zu begründen und die Gerichtskosten für dieses Verfahren einzuzahlen. Erst nach Zahlung der Kosten wird das Verfahren fortgesetzt und Sie erhalten die Möglichkeit, sich zur Klagebegründung zu äußern. Das Gericht prüft dann in einem regulären Zivilprozess, ob die Forderung tatsächlich besteht. Wichtig: Ohne einen ausdrücklichen Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens durch eine der Parteien findet keine Abgabe an das Prozessgericht statt.
Teilwiderspruch: Option bei teilweise berechtigten Forderungen
Manchmal ist die Hauptforderung im Mahnbescheid korrekt, aber Nebenforderungen wie Zinsen oder Mahnkosten sind aus Ihrer Sicht unberechtigt oder überhöht. In solchen Fällen können Sie einen Teilwiderspruch einlegen.
Beim Teilwiderspruch ist es zwingend erforderlich, genau anzugeben, gegen welche Teile der Forderung sich Ihr Widerspruch richtet. Sie müssen also den Betrag oder die Posten (z.B. Zinsen, Mahnkosten, bestimmte Rechnungspositionen) klar benennen, denen Sie widersprechen. Eine Formulierung könnte lauten: „Ich widerspreche der Forderung in Höhe von X € betreffend die Mahnkosten sowie in Höhe von Y € betreffend die Zinsen.“ Die allgemeinen Anforderungen wie die Schriftform, die Zwei-Wochen-Frist und die Unterschrift gelten auch hier. Der Widerspruch kann auch mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts erklärt werden.
Die Konsequenzen eines Teilwiderspruchs sind geteilt:
- Für den Teil der Forderung, dem Sie widersprochen haben, ist das Mahnverfahren beendet. Der Antragsteller muss entscheiden, ob er diesen Teil im streitigen Verfahren (normaler Zivilprozess) weiterverfolgen will.
- Der Teil der Forderung, dem Sie nicht widersprochen haben, bleibt bestehen. Wenn Sie diesen unbestrittenen Betrag nicht bezahlen, kann der Antragsteller hierfür einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Dies ist ein Titel, mit dem er die Zwangsvollstreckung (z.B. Kontopfändung) betreiben kann. Tipp: Zahlen Sie den unbestrittenen Teil der Forderung umgehend, um weitere Kosten und die Zwangsvollstreckung zu vermeiden.
Wichtig: Ein unspezifizierter Teilwiderspruch, bei dem nicht eindeutig hervorgeht, gegen welche Teile des Anspruchs er sich richtet, wird bis zur Klarstellung als unbeschränkter Widerspruch behandelt.
Vollstreckungsbescheid: Rechtliche Folgen bei ausbleibendem Widerspruch
Wenn Sie auf einen Mahnbescheid nicht reagiert haben, droht der nächste Schritt: der Vollstreckungsbescheid. Dieses Dokument ist mehr als nur eine weitere Mahnung – es hat gravierende rechtliche Konsequenzen. Hier erfahren Sie, was Sie unbedingt wissen müssen. Haben Sie auf einen gerichtlichen Mahnbescheid nicht oder nicht fristgerecht mit einem Widerspruch reagiert, kann der Gläubiger als nächsten Schritt den Erlass eines Vollstreckungsbescheids beantragen.
Erhalten Sie dieses Dokument, ist höchste Eile geboten. Denn der Vollstreckungsbescheid hat weitreichende rechtliche Folgen und erfordert Ihr sofortiges Handeln, um erhebliche Nachteile zu vermeiden.
Vollstreckungstitel: Rechtsgrundlage für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
Der Grund, warum ein Vollstreckungsbescheid so ernste Folgen hat, liegt darin, dass er ein sogenannter Vollstreckungstitel ist. Stellen Sie sich dies als eine amtliche Erlaubnis für den Gläubiger vor, seine Geldforderung zwangsweise bei Ihnen einzutreiben. Der Vollstreckungsbescheid ist genau solch ein mächtiger Titel. Praktisch heißt das: Mit diesem Bescheid in der Hand kann der Gläubiger, ohne dass die Berechtigung seiner Forderung in diesem Stadium nochmals gerichtlich geprüft wird, Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einleiten.
Zu den häufigsten Maßnahmen gehören die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers, der bei Ihnen Bargeld oder Wertsachen pfänden kann, oder die direkte Pfändung Ihres Bankkontos (Kontopfändung). Entscheidend zu verstehen ist: Das Gericht hat im vorangegangenen Mahnverfahren nicht inhaltlich geprüft, ob die vom Gläubiger behauptete Forderung überhaupt zu Recht besteht. Es prüft lediglich formale Voraussetzungen.
Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid: Letzte Chance zur Abwehr
Auch wenn der Vollstreckungsbescheid bereits erlassen wurde, haben Sie noch eine Möglichkeit zur Verteidigung: den Einspruch. Dies ist Ihre letzte Chance, die Forderung gerichtlich prüfen zu lassen. Aber Achtung: Hierfür gilt eine sehr strenge Frist von nur zwei Wochen.
Diese zweiwöchige Einspruchsfrist beginnt taggenau mit der Zustellung des Vollstreckungsbescheids bei Ihnen. Das Zustelldatum ist auf dem gelben Umschlag vermerkt, in dem der Bescheid üblicherweise zugestellt wird – heben Sie diesen Umschlag daher gut auf! Versäumen Sie diese absolute Ausschlussfrist, wird der Vollstreckungsbescheid rechtskräftig. Er ist dann wie ein rechtskräftiges Urteil, und der Gläubiger kann die Zwangsvollstreckung ohne weitere Prüfung der Forderung durchführen.
Legen Sie hingegen rechtzeitig schriftlich Einspruch bei dem Gericht ein, das den Bescheid erlassen hat (dem Mahngericht), wird der Rechtsstreit an das zuständige Prozessgericht abgegeben. Erst dann beginnt ein reguläres Gerichtsverfahren (das sogenannte streitige Verfahren), in dem die Berechtigung der Forderung inhaltlich geprüft wird. Sie erhalten dann die Gelegenheit, umfassend zu der Forderung Stellung zu nehmen.
Der Einspruch kann auch elektronisch auf einem sicheren Übermittlungsweg oder bei der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift eingelegt werden. Eine Begründung des Einspruchs ist zunächst nicht erforderlich.
Zahlungsvereinbarungen und Schuldnerberatung: Rechtliche Optionen zur Schuldenregulierung
Auch wenn Sie einen Mahnbescheid erhalten haben und die finanzielle Situation angespannt ist, gibt es Handlungsoptionen. Sie können versuchen, die Schulden strukturiert anzugehen. Dies kann durch eine Vereinbarung mit dem Gläubiger geschehen, beispielsweise über eine Ratenzahlung. Es ist aber auch wichtig zu prüfen, ob die Forderung überhaupt noch rechtlich durchsetzbar ist, etwa wegen Verjährung. Professionelle Unterstützung bieten hierbei Schuldnerberatungsstellen. Eine außergerichtliche Schuldenregulierung ist gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Antrag auf Verbraucherinsolvenz gestellt werden kann.
Ratenzahlungsvereinbarungen: Möglichkeiten und rechtliche Verbindlichkeit
Steht fest, dass die Forderung im Mahnbescheid berechtigt ist, Sie den Betrag aber nicht auf einmal zahlen können, ist eine Ratenzahlungsvereinbarung eine mögliche Lösung. Dabei handelt es sich um eine Abmachung mit dem Gläubiger, die Schuld in festgelegten Teilbeträgen über einen bestimmten Zeitraum zurückzuzahlen.
Eine solche Vereinbarung kann oft ein streitiges Gerichtsverfahren oder die drohende Zwangsvollstreckung nach Erlass eines Vollstreckungsbescheids verhindern. Gehen Sie dafür aktiv auf den Gläubiger zu und schlagen Sie realistische Raten vor, die Sie auch tatsächlich leisten können.
Damit die Vereinbarung klar und für beide Seiten nachvollziehbar ist, sollte sie unbedingt schriftlich festgehalten werden. Wichtige Punkte, die enthalten sein sollten, sind:
- Die Gesamthöhe der geschuldeten Summe (inklusive eventueller Zinsen und Kosten).
- Die genaue Höhe der einzelnen Raten.
- Die Anzahl der Raten bzw. die Gesamtlaufzeit der Vereinbarung.
- Die Fälligkeitstermine für jede Rate (z.B. zum 1. oder 15. eines Monats).
- Regelungen zu eventuell anfallenden Zinsen oder zusätzlichen Gebühren.
- Bestimmungen zur Möglichkeit einer vorzeitigen vollständigen Rückzahlung.
Rechtlich gesehen ist eine Ratenzahlungsvereinbarung ein neuer Vertrag, der die ursprüngliche Zahlungsverpflichtung ändert (§ 311 BGB). Sie kommt nur zustande, wenn der Gläubiger Ihrem Vorschlag zustimmt. Einmal geschlossen, ist sie für beide Seiten verbindlich. Beachten Sie jedoch: Der Abschluss einer solchen Vereinbarung wird oft als Anerkenntnis der Schuld gewertet. Dies kann dazu führen, dass die Verjährungsfrist für die Forderung neu zu laufen beginnt (§ 212 BGB).
Wichtig zu wissen: Auch wenn Sie eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen haben, sollten Sie auf einen gerichtlichen Mahnbescheid trotzdem mit einem Widerspruch reagieren, wenn dieser nach Abschluss der Vereinbarung zugestellt wird. Das Gericht selbst kann keine Ratenzahlung bewilligen, dies ist nur durch den Gläubiger möglich.
Verjährung von Forderungen: Wann Ihre Schuld rechtlich erlischt
Das deutsche Recht sieht vor, dass Ansprüche nicht unbegrenzt geltend gemacht werden können. Dieses Prinzip nennt sich Verjährung. Ist eine Forderung verjährt, bedeutet das nicht, dass sie nicht mehr existiert. Sie als Schuldner erhalten jedoch das Recht, die Zahlung dauerhaft zu verweigern. Dies nennt man die Einrede der Verjährung (§ 214 BGB). Der Gläubiger kann seinen Anspruch dann gerichtlich nicht mehr durchsetzen.
Für die meisten alltäglichen Forderungen (z.B. aus Kaufverträgen, Mieten, Dienstleistungen) gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB).
Diese Frist beginnt jedoch nicht sofort, sondern erst am Ende des Jahres, in dem zwei Bedingungen erfüllt sind (§ 199 BGB):
- Der Anspruch ist entstanden (z.B. die Rechnung wurde fällig).
- Der Gläubiger hat Kenntnis von den Umständen, die den Anspruch begründen, und von der Person des Schuldners erlangt (oder hätte ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis erlangen müssen).
Beispiel:
Sie kaufen im März 2020 etwas und erhalten sofort die Rechnung, die im April 2020 fällig wird. Der Anspruch entsteht 2020, der Gläubiger hat Kenntnis. Die Verjährungsfrist beginnt am 31.12.2020 und endet am 31.12.2023.
Bestimmte Ereignisse können die laufende Verjährung beeinflussen:
- Hemmung: Die Verjährung wird angehalten (pausiert), solange der Hemmungsgrund besteht. Ein wichtiger Hemmungsgrund ist die Zustellung eines Mahnbescheids (§ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Die Zeit der Hemmung wird nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet.
- Neubeginn: Die Verjährungsfrist beginnt komplett von vorne zu laufen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn der Schuldner den Anspruch anerkennt, etwa durch eine Abschlagszahlung, eine Zinszahlung oder eben durch den Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung (§ 212 BGB).
Wichtig im Zusammenhang mit dem Mahnbescheid:
Ob eine Forderung verjährt ist, prüft das Gericht im Mahnverfahren nicht automatisch. Wenn Sie glauben, dass die Forderung verjährt ist, müssen Sie dies aktiv im Widerspruch gegen den Mahnbescheid geltend machen (die „Einrede der Verjährung“ erheben).
Wichtig zu wissen: Die Hemmung der Verjährung durch einen Mahnbescheid setzt voraus, dass der Anspruch im Mahnbescheid hinreichend individualisiert ist. Der Schuldner muss erkennen können, welcher konkrete Anspruch geltend gemacht wird. Zudem beträgt die Hemmung durch den Mahnbescheid sechs Monate. Wird innerhalb dieser Frist kein Vollstreckungsbescheid beantragt oder bei Widerspruch kein streitiges Verfahren eingeleitet, läuft die Verjährungsfrist weiter.